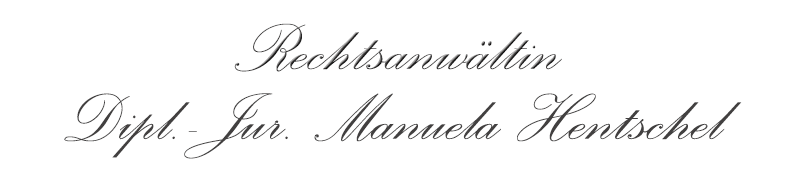Als Rechtsanwältin bin ich seit 1990 in eigener Kanzlei in Wilkau-Haßlau (in der Nähe von Zwickau) tätig.
Unsere Schwerpunkte liegen hierbei im Erbrecht, Grundstücks- und immobilienrecht und Familienrecht.
Nutzen Sie unsere jahrelange Erfahrung in diesen Rechtsgebieten. Wir bieten unseren Mandanten eine allumfassende Beratung.
Zusammen mit einem kompetenten Team berate und vertrete ich Sie persönlich, individuell und kostentransparent.
Unsere Leistungen umfassen die Beratung, Betreuung und Vertretung sowohl von Privatpersonen als auch von klein- und mittelständischen Unternehmen.
Wir vertreten Sie vor allen Amtsgerichten einschl. Familiengerichten und Landgerichten sowie dem Oberlandesgericht Dresden.
Im weiteren ist eine anwaltliche Vertretung des Deutschen Rechts europaweit möglich.
Aktuelles
15.11.2024
Sterbegeldversicherung: Auszahlung gehört zum Erbe
Viele Menschen wollen ihre Familien mit einer Sterbegeldversicherung vor hohen Kosten einer Trauerfeier schützen. Dabei ist laut BFH zu beachten, dass dieses Geld zum Erbe zählt und zu einer Erhöhung des Nachlasses führt. Dafür seien aber die Beerdigungskosten nicht nur pauschal, sondern vollständig steuermindernd zu berücksichtigen.
Ein Geschwisterpaar, Bruder und Schwester, sind Erben ihrer 2019 verstorbenen Tante, die eine Sterbegeldversicherung abgeschlossen hatte. Die Versicherungssumme reservierte sie für das Bestattungsinstitut, das die Trauerfeier durchführen sollte. Nach dem Tod der Frau stellte das Bestattungsinstitut über 11.000 Euro in Rechnung. Die Versicherung übernahm davon knapp 6.900 Euro.
Das zuständige Finanzamt setzte gegen den Bruder Erbschaftsteuer fest und rechnete den von der Versicherung übernommenen Betrag zum Nachlass. Für die geltend gemachten Nachlassverbindlichkeiten - einschließlich der Kosten für die Bestattung - setzte das Finanzamt lediglich die Pauschale für Erbfallkosten nach § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 2 ErbStG in Höhe von 10.300 Euro an. Das war dem Bruder zu wenig. Er wollte, dass die vollen Kosten der Beerdigung von der Steuer absetzt werden.
Während das FG Münster die Klage noch als unbegründet zurückgewiesen hatte, hob der BFH auf die Revision auf und verwies die Sache zurück (Urteil vom 10.07.2024 - II R 31/21). Zwar sei aufgrund der von der Erblasserin abgeschlossenen Sterbegeldversicherung ein Sachleistungsanspruch in Bezug auf die Bestattung auf die Erben übergegangen. Dieser fiel in Höhe der Versicherungsleistung von 6.864,82 Euro in den Nachlass und erhöhte die Bemessungsgrundlage der Erbschaftsteuer.
Anders als vom FG angenommen seien die Bestattungskosten aber nicht nur in Höhe von 10.300 Euro, also der Pauschale des § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 2 ErbStG absetzbar. Sie seien vielmehr nach § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 1 ErbStG im vollen Umfang als Nachlassverbindlichkeiten bei der Bemessung der Erbschaftsteuer steuermindernd zu berücksichtigen.
Da die Feststellungen des FG nicht ausreichten, um die Höhe der insgesamt zu berücksichtigenden Nachlassverbindlichkeiten abschließend zu bestimmen, musste das Verfahren zurückverwiesen werden.
BFH, Urteil vom 10.07.2024 - II R 31/21
25.09.2024
Wirksames Testament auf der Intensivstation? Krankenhaus muss Behandlungsakte herausgeben
Die neu als Erben eingesetzten Verwandten hatten auch eine postmortale Vollmacht – und wohl kein Interesse daran, dass die Testierfähigkeit ihrer toten Tante überprüft wird. Trotz ihrer fehlenden Erlaubnis verpflichtete das OLG Hamm die Klinik, dem Gerichtsgutachter die Befunde zu geben.
Eine inzwischen verstorbene Frau hatte im Krankenhaus ihr altes Testament geändert. Ursprüngliche Alleinerbin war ihre Schwester. Die Beurkundung fand auf der Intensivstation statt, wo die Erblasserin wegen einer lebensbedrohlichen Entzündung der Bauchspeicheldrüse behandelt wurde. Neben ihrer Nichte benannte sie noch deren zwei Kinder als Erben. Damit war ihre Schwester nicht einverstanden. Sie behauptete, die Erblasserin sei zum Zeitpunkt der Beurkundung gar nicht testierfähig gewesen. Daraufhin bestellte das Gericht einen Gutachter. Die Klinikträgerin weigerte sich aber, die Unterlagen herauszurücken, und berief sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht. Es bestehe eine postmortale Vollmacht zugunsten der Kinder und diese hätten die Klinik nicht von ihrer ärztlichen Schweigepflicht entbunden.
Das OLG Hamm hat die Klinik in einer Zwischenentscheidung verpflichtet, die Krankenunterlagen der Erblasserin dem Gutachter vorzulegen (Beschluss vom 13.06.2024 – 10 W 3/23). Zunächst sei die Schweigepflicht als höchstpersönliches Recht nicht vererblich. Schon aus diesem Grund stehe den Kindern entgegen der Annahme der Klinikträgerin die Entscheidung über die ärztliche Schweigepflicht betreffend die Behandlung der Verstorbenen nicht zu. Die vom Krankenhaus ins Spiel gebrachte postmortale Vorsorgevollmacht zugunsten der Kinder ändere daran nichts, da sie vom selben Tag wie das Testament stamme und somit ebenfalls von der (behaupteten) Geschäftsunfähigkeit betroffen sein könnte.
Verstorbene hätte im Zweifel Klärung gewünscht
Hätte sich die Verstorbene ausdrücklich zur Frage der ärztlichen Schweigepflicht nach ihrem Tod geäußert, wäre diese Anweisung bindend, so der Senat. Da sie dies nicht getan habe, sei ihr mutmaßlicher Wille ausschlaggebend. Für das Richterkollegium stand fest, dass die Seniorin Zweifel an ihrer Testierfähigkeit hätte klären lassen wollen: Es liege typischerweise im Interesse eines Erblassers, Bedenken hinsichtlich an der Wirksamkeit seines Testaments auszuräumen.
Die Kosten des Zwischenverfahrens muss nach der Entscheidung des OLG die Klinikträgerin übernehmen.
OLG Hamm, Beschluss vom 13.06.2024 - 10 W 3/23
29.08.2024
Nicht jede Demenz macht Testament unwirksam
Auch eine an Demenz erkrankte Person kann noch in der Lage sein, ein Testament wirksam zu errichten. Hievon geht das LG Frankenthal regelmäßig aus, wenn die Erkrankung sich noch in einem leichtgradigen Stadium befindet.
Entscheidend ist für das Gericht, ob die betreffende Person die Tragweite ihrer Anordnungen trotz ihrer Erkrankung noch klar beurteilen kann und in der Lage ist, frei von Einflüssen Dritter zu entscheiden. Das LG unterscheidet dazu zwischen leichtgradiger, mittelschwerer und schwerer Demenz und geht bei einem leichten Grad in der Regel davon aus, dass die Person noch testierfähig ist.
So auch im Fall einer im Alter von 90 Jahren verstorbenen Frau, die kurz vor ihrem Tod vor einem Notar ein Testament errichtet hatte, mit dem sie dem Sohn einer Freundin ein wertvolles Anwesen vermachte. Der Notar hatte in der Urkunde schriftlich festgehalten, dass er die Frau für unbeschränkt geschäfts- und testierfähig hält. Der Testamentsvollstrecker sah dies anders und begehrte Eilrechtsschutz. Er legte Arztbriefe vor, aus denen eine "beginnende demenzielle Entwicklung", eine "demenzielle Entwicklung" und eine "bekannte Demenz" der Erblasserin hervorgingen.
Das reichte dem LG Frankenthal im Eilverfahren nicht aus (Urteil vom 18.07.2024 – 8 O 97/24, nicht rechtskräftig). Es sei Sache des Testamentsvollstreckers, die Testierunfähigkeit der verstorbenen Frau zu beweisen. Dass ihm das im Hauptsacheverfahren gelingen kann, sahen die Richter als nicht überwiegend wahrscheinlich an. Bei den vorgelegten Unterlagen fehle es unter anderem an einer Einstufung des Grades der Demenz. Ohne die aber könne keine verlässliche Aussage getroffen werden.
LG Frankenthal, Urteil vom 18.07.2024 - 8 O 97/24
07.06.2023
Wie lange darf die Erstellung eines Nachlassverzeichnisses dauern?
Der Testamentsvollstrecker ist gesetzlich verpflichtet, den Erben "unverzüglich" nach der Annahme seines Amtes ein Verzeichnis über den seiner Verwaltung unterliegenden Nachlass vorzulegen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat entschieden, dass dies aber nicht zwingend bedeute, dass die Erstellung innerhalb weniger Wochen erfolgen muss. Vielmehr könne dies bei einem größeren und komplexeren Nachlass auch längere Zeit in Anspruch nehmen.
zu OLG Düsseldorf, Beschluss vom 24.01.2023 - I-3 Wx 105/22
18.04.2023
Irrtum bei lenkender Erbausschlagung
Schlägt jemand eine Erbschaft aus, weil er denkt, dass dadurch seine Mutter zur Alleinerbin wird, kann er diese Erklärung nicht anfechten, wenn er erfährt, dass eine andere Person in die Erbfolge eintritt. Der Bundesgerichtshof betrachtet dies als einen unbeachtlichen Motivirrtum, der nicht zur Anfechtung berechtigt. Ein Erbe sollte sich vor der Ausschlagung über alle tatsächlichen und rechtlichen Umstände des Erbfalls informieren.
zu BGH, Beschluss vom 22.03.2023 - IV ZB 12/22
19.01.2023
Durch Testament eingesetzter Erbe trägt Risiko der Unwirksamkeit
Ein durch Testament eingesetzter Erbe trägt auch bei Gutgläubigkeit das Risiko der Unwirksamkeit. Hierauf wies das Oberlandesgericht Celle hin. Hintergrund ist der Fall eines Steuerberaters, der von einer alleinstehenden Frau mit Millionen-Vermögen als Erbe vorgesehen war. Das Landgericht hatte Ende 2021 festgestellt, dass er nicht Erbe geworden ist. Seine dagegen eingelegte Berufung nahm er jetzt nach einem Hinweis des OLG zurück.
zu OLG Celle - 6 U 2/22
01.12.2022
Gegenseitige Erbeinsetzung muss gemeinschaftlichem Testament klar zu entnehmen sein
Legen Eheleute in einem gemeinschaftlichen Testament fest, dass ihre Tochter nach dem Tod des länger lebenden Ehegatten das Wohnhaus erhalten soll, so ist hierin keine Erbeinsetzung der Tochter zu sehen, wenn neben der Immobilie noch weiteres wesentliches Vermögen vorhanden ist. Dies schließt es zugleich aus, aus der Regelung zugunsten der Tochter auf eine gegenseitige Erbeinsetzung der Eheleute zu schließen, wie das Oberlandesgericht Brandenburg entschieden hat.
zu OLG Brandenburg, Beschluss vom 09.08.2022 - 3 W 67/22
27.10.2022
Neue Partnerschaft hat nicht zwangsläufig Verlust des Erbrechts zur Folge
Wenn jemand seinen Lebenspartner testamentarisch zum Erben einsetzt, aber sich dieser noch zu Lebzeiten des Erblassers anderweitig bindet, kann dies zur Unwirksamkeit des Testaments führen. Etwas anderes kann allerdings dann gelten, wenn der Erbe nur deswegen eine neue Partnerschaft eingegangen ist, weil die fortgeschrittene Demenz des Erblassers eine Beziehung mit ihm unmöglich machte. Entscheidend ist laut Oberlandesgericht Oldenburg der hypothetische Wille des Erblassers.
zu OLG Oldenburg, Beschluss vom 26.09.2022 - 3 W 55/22
05.10.2022
Fehlende gegenseitige Erbeinsetzung in einem gemeinschaftlichen Testament
Zwar ist dem gemeinschaftlichen Testament der Wunsch der Eheleute zu entnehmen, dass die im Testament genannten Personen nach dem Tod des länger lebenden Ehegatten das Wohnhaus erhalten sollten, doch reicht dies - so das OLG Brandenburg - nicht aus, um das Testament dahingehend auszulegen, dass die Eheleute sich gegenseitig als Alleinerben des gesamten Nachlasses einsetzen wollten.
OLG Brandenburg, Beschluss vom 09.08.2022 - 3 W 67/22, BeckRS 2022, 22068
02.05.2022
Auskunftsverlangen ist kein Fordern des Pflichtteils im Sinne einer Sanktionsklausel in einem gemeinschaftlichen Testament
09.02.2022
Verzicht auf Pflichtteil zu Lasten der Sozialhilfe
15.01.2022
BGH-Urteil im Erbrecht: Grabpflegekosten keine den Pflichtteil kürzende Nachlassverbindlichkeit
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 26.05.2021 (Az.: IV ZR 174/20) entschieden, dass Grabpflegekosten keine den Pflichtteilsanspruch kürzende Nachlassverbindlichkeit darstellen, wenn sie testamentarisch angeordnet sind.
17.12.2021
Notarielles Nachlassverzeichnis kann an Eides Statt versichert werden
Bieten die Angaben des Erben zu Zweifeln Anlass, ob die Erstellung des Nachlassverzeichnisses sorgfältig erfolgt ist, kann der Pflichtteilsberechtigte von ihm verlangen, die Richtigkeit aller aufgeführten Positionen an Eides Statt zu versichern. Der Bundesgerichtshof hält es dabei für irrelevant, ob das Verzeichnis von einem Notar oder von dem Erben selbst erstellt worden ist. Damit ist dieser Streit erstmalig höchstrichterlich entschieden worden.
zu BGH, Urteil vom 01.12.2021 - IV ZR 189/20
20.10.2021
Anspruch auf Wertermittlung auch nach Veräußerung eines Erbstücks
Ein Pflichtteilsberechtigter hat auch nach dem Verkauf eines Nachlassgegenstands einen Anspruch auf Wertermittlung. Laut Bundesgerichtshof besteht hierfür jedenfalls dann ein berechtigtes Interesse, wenn bereits mehrere unterschiedliche Expertisen vorliegen und damit die Auskünfte des Erbe kein klares Bild zeichnen. Andernfalls werde der Nachweis verwehrt oder zumindest erschwert, dass der Veräußerungserlös nicht dem tatsächlichen Verkehrswert entsprochen habe.
zu BGH, Urteil vom 29.09.2021 - IV ZR 328/20